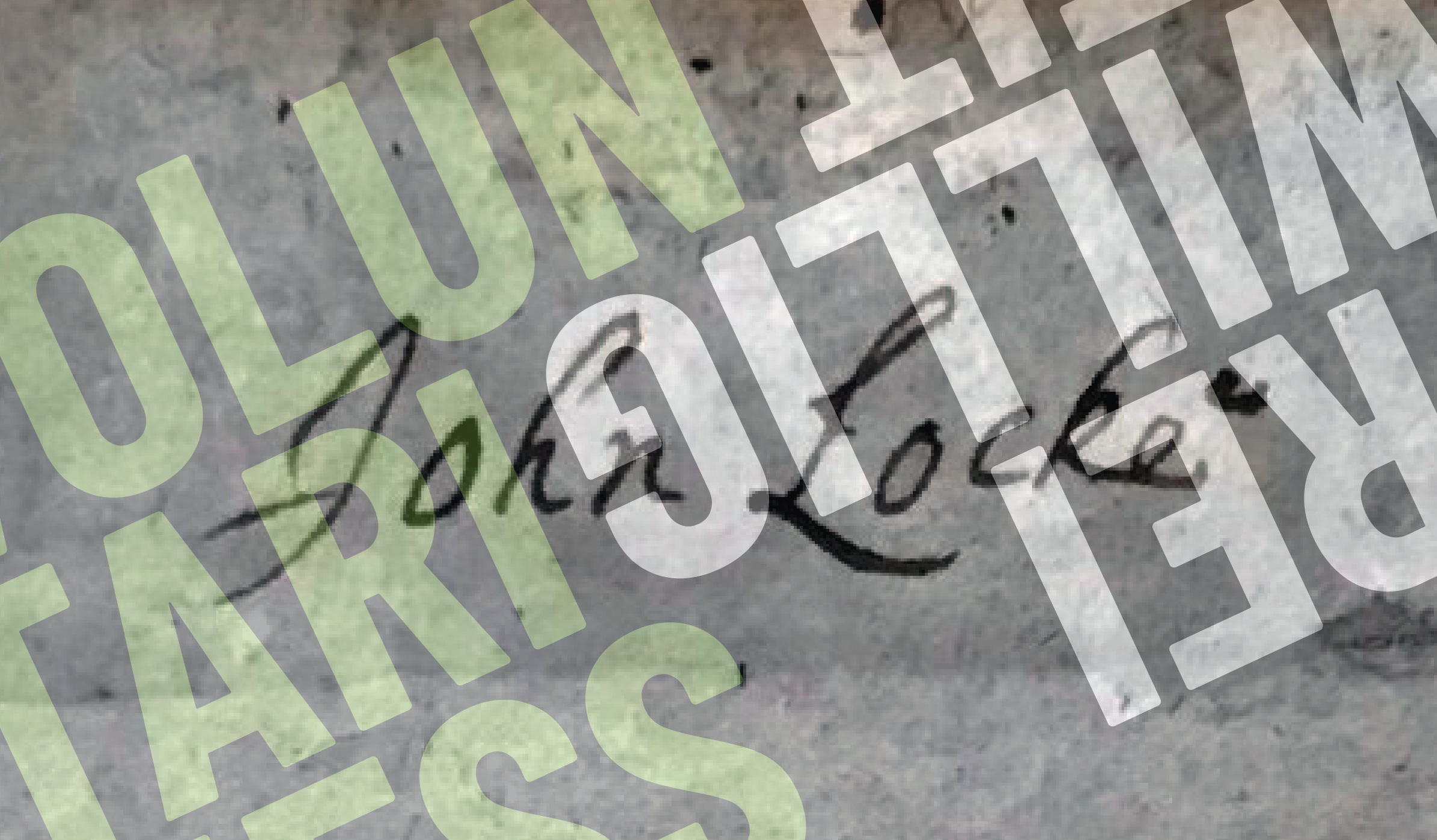Freiwilligkeit und Resilienz in Zeiten der Vielfachkrise
Als in diesem Sommer Deutschlands Südwesten von einem „Jahrhunderthochwasser“ heimgesucht wurde, dominierte im medialen Diskurs zunächst vor allem eins: Schock und Betroffenheit. An Bilder von im Strom trudelnden Autos, rutschenden Hängen oder abgerissenen Dächern sind Leser*innen und Fernsehzuschauer*innen hierzulande zwar seit jeher gewöhnt – nicht aber daran, dass diese Bilder mehr oder weniger nahe von ihrem eigenen Zuhause aufgenommen wurden. Kein Zweifel: Die Klimakrise, deren ursächliche Rolle für die Katastrophe niemand mehr ernsthaft bestreitet, ist in Mitteleuropa angekommen. Und mit der Krisenwahrnehmung wird die Frage wichtiger, ob beziehungsweise wie Katastrophen wie diese zukünftig verhindert werden können. Während die meisten Spitzenpolitiker*innen nicht müde werden zu betonen, man dürfe jetzt keinesfalls Klimaanpassung gegen Klimaschutz ausspielen, verfestigt sich bei vielen Menschen der Eindruck, der Zug für Letzteres sei möglicherweise doch schon abgefahren. Tatsächlich scheint die Welt in einem Dauerkrisenmodus verfangen, in dem sich „Schockwellen in Windeseile über alle Grenzen hinweg“ ausbreiten. Angesichts dessen traf der bekannte ZDF-Moderator Claus Kleber die Stimmung auf den Punkt, als er kurz nach der Hochwasserkatastrophe forderte, man solle doch jetzt die „philosophischen Debatten über Klimawandel“ auf die Seite legen und stattdessen die drängendere Frage beantworten, „wie passen wir uns an“.
In der Berichterstattung über die Flut waren aber auch hoffnungsvolle Töne zu vernehmen, begleitet von Bildern, auf denen freiwillige Helfer*innen ganz unphilosophisch die Ärmel hochkrempeln, Schutt wegräumen, Wasser schippen oder Kleidung verteilen. In das allgemeine Lob der Freiwilligkeit mischten sich freilich schnell wiederum auch skeptische Töne: Nicht nur hatten sich Rechtsextreme unter die Helfer*innen gemischt – auch diejenigen ohne fragwürdige politische Agenda kamen angesichts der nur schleppend anlaufenden staatlichen Krisenhilfe sehr schnell an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.
Freiwilligkeit, das zeigt dieses Beispiel, kommt in Krisen- und Katastrophensituationen ein besonderer Stellenwert zu. Sie wird zu einer Ressource der Bewältigung – sowohl in materieller wie in emotionaler und sozialer Hinsicht. Im medialen Lob der spontanen, freiwilligen Hilfe vergewissert sich die Gesellschaft darüber hinaus, dass ihre normativen Grundlagen auch im Angesicht von Krisen und Katastrophen bestehen bleiben. Freiwilligkeit ist dementsprechend sowohl Ressource, Diskurs und Norm als auch fragil: Weil Freiwilligkeit zwar erhofft und angereizt, nicht aber im Detail diktiert werden kann, läuft sie Gefahr, zu scheitern, missbraucht zu werden oder unvorhergesehene neue Probleme zu produzieren.
Von der Krisenbewältigung zur Dividende der Resilienz
Es sind also nicht nur, aber auch und vor allem Krisen- und Umbruchsituationen, in denen die Gesellschaft nach Freiwilligkeit verlangt. Unter den Bedingungen der gegenwärtigen politischen, sozialen, ökologischen, ökonomischen Vielfachkrise expandiert Freiwilligkeit dementsprechend über traditionelle Felder von bürgerschaftlichem Engagement und Nachbarschaftshilfe hinaus. Krisen und Katastrophen sind das neue Normal geworden, auch (und das ist das eigentlich Neue) in den bis dato vergleichsweise eher komfortablen Regionen der Welt. Gestützt und begleitet wird Freiwilligkeit dabei zunehmend von einem anderen Konzept, das in den letzten Jahren ebenfalls erhebliche Aufmerksamkeit generiert hat: Resilienz. Gemeint damit ist die Fähigkeit von Systemen und Subjekten im Angesicht von Krisen, Schocks und Katastrophen „abzufedern“. Ob Burnout oder Terrorismus, Fluchtmigration oder Krebserkrankung, Viruspandemie oder Arbeitslosigkeit – für alle nur denkbaren Probleme bietet sich Resilienz als Lösung an. Dabei ist Resilienz, wie immer wieder betont wird, keineswegs allen gegeben: Was die einen umbringt, macht die anderen stark. Die gute Botschaft wird jedoch meist gleich mitgeliefert: Resilienz ist kein Schicksal, sondern lässt sich, unter Anleitung einschlägiger Expert*innen, trainieren.

Auf diese Weise wird der Einzelnen eine erstaunliche Macht zugeschrieben – nämlich die, ihr Leben auch in einer radikal unsicheren Welt immer noch optimal zu gestalten Dabei tritt die Frage nach den Ursachen von Krisen, aber auch die Unterschiede zwischen Alltagsstress und Trauma, Natur- und menschengemachten Katastrophen in den Hintergrund. Doch es geht nicht nur um Bewältigung. Krisen und Katastrophen lassen sich, glaubt man der Botschaft der Resilienz, nicht nur durchstehen, sondern mehr noch, in Wachstumsgelegenheiten verwandeln. Damit folgt Resilienz dem Mantra des neoliberalen Kapitalismus, demzufolge Krisen vor allem Chancen darstellen – jedenfalls für diejenigen, die es schaffen, ihr Mindset gnadenlos auf Erfolg zu trimmen. Resilienz fügt diesem ebenso bekannten wie realitätsfernen Glaubenssatz nun noch eine kleine, aber entscheidende Prise Gegenwartsbezug bei: Nicht nur Krisen und Alltagssorgen, auch veritable Katastrophen lassen sich, so das Versprechen der Resilienz, potenziell in etwas Wunderbares transformieren.
Eine ideale Gelegenheit für das Training von Resilienz bzw. „Unsicherheitstoleranz“ stellt nach Ansicht von Resilienzexpertin Jutta Heller beispielsweise auch die diesjährige Hochwasserkatastrophe dar. Angesichts der Fluten wie des Klimawandels komme es darauf an, den Bick immer wieder aufs Positive zu richten, und sich auf das „was heilgeblieben ist“ zu konzentrieren; keinesfalls soll man „im Jammermodus bleiben“. Auf diese Weise lässt sich Heller zufolge nicht nur die konkrete Schadenslage besser bewältigen, sondern aus der Katastrophe heraus auch neues Innovationspotenzial – die andernorts auch so genannte Dividende der Resilienz – erschließen. Wer die Blickrichtung ändert, entdeckt womöglich in den Trümmern des eigenen Hauses den Ansatz für ein neues, viel erfolgreicheres Leben. Der für die neoliberale Alltagsideologie so typische Cruel Optimism wird im Zeichen von Resilienz auf diese Weise um die Feier der Katastrophe erweitert.
Die Kunst, freiwillig gefährlich zu leben
Ähnlich wie Freiwilligkeit ist also auch Resilienz nicht nur ein wissenschaftlicher Schlüsselbegriff des 21. Jahrhunderts, sondern auch ein – freilich hochproblematischer – normativer Haltegriff im neoliberalen Krisenkapitalismus der Gegenwart. Als resilient erweist sich bisher allerdings vor allem der Neoliberalismus selbst – paradoxerweise nicht trotz, sondern gerade wegen seiner vielfältigen ökologisch wie sozial destruktiven Auswirkungen, die wiederum den Einsatz von Schocktherapien Strukturanpassungsprogrammen und die immer weiter reichende Vermarktlichung aller Lebensbereiche rechtfertigen.
Gemeinsam ist Freiwilligkeit und Resilienz, dass sie Situationen verändern und Probleme lösen wollen. Zudem versprechen beide eine Win-win-Situation: Wer freiwillig handelt oder Resilienz trainiert, tut nicht nur notleidenden Anderen, der Gesellschaft oder dem eigenen Arbeitgeber einen Gefallen, sondern letztlich auch sich selbst. Zugleich unterscheiden sie sich: Freiwilligkeit ist letztlich nur dort von Belang, wo sie sich tatsächlich in Handlung umsetzt. Psychologische Resilienz hingegen spielt sich vor allem auf der Innenseite des Subjekts ab: Es geht darum, das eigene Mindset im Strom der großen und kleinen Katastrophen immer wieder in Richtung Wachstum und Optimismus zu kalibrieren.

Die wichtigste Differenz zwischen Freiwilligkeit als gouvernementale Handlungsnorm und Resilienz als Art of Living Dangerously hat jedoch mit der grundlegenden Verfasstheit moderner Gesellschaften selbst zu tun. Zwar wird Freiwilligkeit paradoxerweise auch in Diktaturen erfolgreich mobilisiert. Zugleich aber ist sie so etwas wie eine demokratische Basistugend. Namentlich die Parteiendemokratie lebt vom freiwilligen Engagement ihrer Bürger*innen. Diese Verbindung von Demokratie und Freiwilligkeit ist nun alles andere als eindeutig oder unproblematisch. Im Kern aber zielt sie auf gesellschaftliche Stabilisierung und Integration. Demgegenüber ist nicht Demokratie, sondern der zur Normalität gewordene Ausnahmezustand das natürliche Habitat des resilienten Subjekts. Optimistische Visionen meinen zwar auch hier eine typisch neoliberale Win-win-Situation zu erkennen und beschreiben enthusiastisch die Potenziale „resilienter Demokratien“ Aber eine selbstverständliche Verbindung von Demokratie und Resilienz existiert nicht.
Zusammen kommen Freiwilligkeit und Resilienz, wo die Grenzen zwischen Selbsthilfe und Engagement für andere im Horizont der antizipierten oder bereits eingetretenen Katastrophe verschwimmen.
Zwecks Bewältigung der – wesentlich durch neoliberale Austeritätspolitik hervorgerufenen – Krise des Wohlfahrtsstaats im globalen Norden setzt man auf nationaler Ebene seit Jahren auf nicht-entlohnte freiwillige Arbeit in Gestalt von Ehrenämtern, Nachbarschaftshilfe oder Community Organizing. Die Ursachen für die Probleme, die es zu bewältigen gilt, werden dabei einerseits individualisiert, andererseits wird ihre Bewältigung als Empowerment und Persönlichkeitswachstum gerahmt. Immer häufiger wird inzwischen auch Resilienz als Zielhorizont formuliert – auch in internationalen Programmen der Krisenbewältigung (u. a. bei der UN und WHO).
Sind Freiwilligkeit und Resilienz also Teil der Lösung oder nicht doch eher Teil des Problems? Das lässt sich so einfach nicht beantworten. Selbstverständlich: Resilienz, verstanden als individuelle und kollektive Krisenfestigkeit, ist etwas, das Menschen in akuten Notsituationen unbedingt brauchen können, und brauchen tun sie angesichts des immer wieder frappierenden Politikversagens sehr häufig auch die freiwillige Hilfe von engagierten Mitmenschen. Denn alleine wird der Vielfachkrise, zumal in ihrer ökologischen Dimension, jedoch mittel- und langfristig kaum beizukommen sein: Es wird wohl auch um die Infragestellung von Machtstrukturen und Lebensweisen gehen müssen. Und dafür braucht es mehr und anderes als Freiwilligkeit und Resilienz (die eher dazu beitragen, den Status Quo zu verfestigen als dazu ihn zu verändern): die Fähigkeit zur Kritik, zum Konflikt und, last but not least, zur Imagination: Eine andere als bloß katastrophale Welt sollte möglich bleiben, auch in unseren Köpfen.
Zitiervorschlag: Graefe, Stefanie: “Mit Schockwellen leben: Freiwilligkeit und Resilienz in Zeiten der Vielfachkrise”, Freiwilligkeit: Geschichte – Gesellschaft – Theorie, Oktober 2021, https://www.voluntariness.org/de/mit-schockwellen-leben/